Long COVID – aktueller Überblick und Einordnung neuromodulatorischer Forschungsansätze
Hinweis: Dieser Beitrag dient der neutralen, allgemeinverständlichen Information zum aktuellen Forschungsstand. Er enthält keine Heilaussagen und stellt keine Aussage zur Wirksamkeit konkreter Produkte dar. Betroffene sollten medizinischen Rat bei Fachpersonal einholen.
Mit mehr als 4 Millionen Todesfällen und etwa 200 Millionen bestätigten Fällen weltweit in 18 Monaten wurde COVID-19 von internationalen Organisationen (u. a. Weltgesundheitsorganisation, WHO) als die erste Krankheit seit der Spanischen Grippe-Pandemie bewertet, die eine dringliche globale Gesundheitsreaktion erforderlich machte.
Ungeachtet von Verzögerungen und Unstimmigkeiten in verschiedenen Ländern wurden bis August 2021 insgesamt rund 4,91 Milliarden Impfdosen verabreicht, um den Verlauf der Pandemie zu beeinflussen.
Auch wenn die Zahl der täglichen neuen COVID-19-Fälle und der COVID-19-bedingten Todesfälle in manchen Phasen rückläufig war, rücken langfristige Auswirkungen einer COVID-19-Infektion zunehmend in den Fokus der öffentlichen Gesundheit.
Bereits in den frühen Monaten der Pandemie wurden Symptome beschrieben, die über den erwartbaren Verlauf hinaus anhalten. Im Dezember 2020 veröffentlichte das National Institute for Health and Care Excellence (NICE) Leitlinien für Ärztinnen und Ärzte, die darauf hinweisen, dass einige Patientinnen und Patienten anhaltende, teils multiorgane Symptome und Komplikationen über die akute Infektionsphase hinaus aufweisen.
Diese längerfristigen Folgen, häufig als „postakutes COVID-19“ oder „Long COVID“ bezeichnet, werden inzwischen als häufiges Syndrom beschrieben, das sowohl bei Menschen mit schwerem akutem COVID-19 als auch bei Personen mit milden oder asymptomatischen Verläufen diagnostiziert werden kann.
In einigen Publikationen wird geschätzt, dass bis zu 87 % der hospitalisierten und etwa 35 % der ambulant behandelten Patientinnen und Patienten Long-COVID-Symptome entwickeln könnten. Diese Größenordnungen werden in der Fachliteratur diskutiert und unterstreichen die Bedeutung des Themas für das öffentliche Gesundheitswesen.
Symptome und mögliche Ursachen von Long COVID
Long COVID wird als heterogenes Syndrom beschrieben, das mit unterschiedlichen, länger anhaltenden Beschwerden assoziiert sein kann, darunter u. a. Müdigkeit, anhaltender Husten, Atemnot, Muskel- und Knochenschmerzen, geschwollene Nasenschleimhäute, Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn, Halsschmerzen, Herzrasen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, kognitive Beeinträchtigungen, Schwierigkeiten beim Halten der aufrechten Position und Muskelschwäche.
Unterschiedliche Symptomcluster werden mit verschiedenen biologischen Erklärungsansätzen in Verbindung gebracht, die in der Wissenschaft diskutiert werden, darunter:
- Direkte Gewebeschäden in einer oder mehreren Körperregionen im Zusammenhang mit der vorangegangenen Infektion,
- Persistierende Virusreservoire (SARS-CoV-2-Fragmente) mit daraus resultierenden chronischen Entzündungsreaktionen,
- Dysautonomie (Störungen des autonomen Nervensystems) im Zusammenhang mit Infektionen von Endothelzellen, extrakardialen postganglionären sympathischen Neuronen oder Hirnstammregionen (u. a. diskutiert in Goldstein 2021; Proal & VanElzakker 2021),
- Reaktivierungen neurotropher Pathogene unter Bedingungen einer durch COVID-19 ausgelösten Immunfehlfunktion,
- Autoimmunität infolge molekularer Ähnlichkeiten zwischen Pathogen- und Wirtsproteinen.
Menschen, die während der akuten Phase asymptomatisch waren und später wiederkehrende Beschwerden entwickeln, werden mitunter mit möglichen persistierenden Virusreservoiren in Verbindung gebracht; bei Patientinnen und Patienten mit Hospitalisierung während der Akutphase werden längerfristige Symptome in der Diskussion eher mit Gewebeschäden in einer oder mehreren Körperregionen verknüpft.
Im Unterschied zur Epidemiologie des akuten COVID-19 (wo männliche Personen und über 50-Jährige stärker betroffen sein können) wird Long COVID häufig bei relativ jungen und überwiegend weiblichen Betroffenen berichtet. Diese Beobachtung stützt Hypothesen, wonach die Reaktivität des Immunsystems (z. B. Entzündung oder Autoimmunität) eine Rolle bei der Entwicklung chronischer Symptome spielen könnte und daher in therapeutischen Überlegungen Beachtung findet.
In diesem Zusammenhang wird diskutiert, dass Frauen im Durchschnitt stärkere Immunantworten zeigen – evolutionsbiologisch u. a. mit Schwangerschaftsschutz in Verbindung gebracht –, was allerdings mit einer höheren Prävalenz von Autoimmunerkrankungen einhergehen kann.
Einige Studien zu Long COVID berichten über Autoantikörper gegen unterschiedliche Gewebe, die verschiedene Symptome – von kognitiven Einschränkungen bis zu Veränderungen der autonomen Regulation (Dysautonomie) – mit erklären könnten; teilweise werden höhere Autoantikörperspiegel bei Frauen beschrieben.
Darüber hinaus wurde festgehalten, dass T-Zellen – eine Gruppe von Lymphozyten, die virusinfizierte Zellen eliminieren – bei Frauen in bestimmten Kontexten aktiver sein können, was zu einer günstigeren frühen Immunreaktion beitragen könnte; gleichzeitig werden in der Diskussion chronische Entzündungswellen und erhöhte Zytokinspiegel im Zusammenhang mit persistierenden Virusfragmenten genannt, die bei einigen Betroffenen Symptome wie Schmerzen, Müdigkeit oder „Hirnnebel“ begleiten.
Unabhängig vom genauen pathophysiologischen Mechanismus – virusvermittelt oder immunologisch – wird eine gestörte Signalverarbeitung im Hirnstamm als ein möglicher Treiber bei einem Teil der Long-COVID-Symptomatik diskutiert.
Wie bereits erwähnt, unterscheidet sich die epidemiologische Verteilung von Long COVID von jener des akuten COVID-19. Häufig werden jüngere und weibliche Betroffene genannt. Diese Beobachtung korrespondiert mit der Hypothese, dass immunologische Reaktivität (Entzündung/Autoimmunität) maßgeblich zur Symptomchronifizierung beitragen kann und entsprechend in der Forschung besondere Beachtung findet.
Vor diesem Hintergrund wird erneut hervorgehoben, dass Frauen im Durchschnitt robustere Immunantworten aufweisen, was evolutionsbiologisch u. a. mit dem Schutz des Nachwuchses erklärt wird, jedoch auch mit einer höheren Rate autoimmuner Erkrankungen assoziiert sein kann.
Mehrere Arbeiten berichten bei Long-COVID-Kohorten über selbstgerichtete Autoantikörper gegen verschiedene Zielgewebe. Dies wird als mögliche Erklärung für verbreitete Symptome (z. B. kognitive Dysfunktion, autonome Dysregulation) diskutiert; in manchen Auswertungen werden höhere Spiegel bei Frauen beschrieben.
Ergänzend wird diskutiert, dass T-Zell-Aktivität bei Frauen in bestimmten Phasen ausgeprägter sein kann und damit ein günstigeres Ansprechen in der Frühphase begünstigt; verbleibende Virusfragmente könnten jedoch – so die Hypothese – eher proinflammatorische Zyklen und erhöhte Zytokinlevel auslösen, was Symptome wie Schmerzen, Müdigkeit und kognitive Beeinträchtigungen mitbedingt.
Zusammenfassend wird eine Hirnstamm-Dysregulation in der Literatur als einer von mehreren möglichen Faktoren erörtert, die bei einem Teil der Betroffenen zur Symptomatik beitragen könnten.
Parasym und Long COVID (Forschungsberichte)
In einem jüngst kommunizierten Projekt in Zusammenarbeit mit der Human Waves Clinic und der Université Libre de Bruxelles wurde die Anwendung einer neuromodulatorischen Technologie des Unternehmens Parasym bei Long-COVID-Betroffenen evaluiert. Nach Angaben der Beteiligten wurden in dieser Untersuchung Veränderungen sowohl in physiologischen als auch in patientenberichteten Parametern festgestellt. Berichtet wurden u. a. statistisch signifikante Veränderungen bei Ermüdungsmaßen, depressiven Symptomen und gebündelten Long-COVID-Symptomskalen sowie Hinweise auf Veränderungen des autonomen Tons und der Griffkraft.
Wichtig ist die wissenschaftliche Einordnung: Bei den genannten Ergebnissen handelt es sich um vorläufige Befunde aus einer spezifischen Untersuchung. Parasym gab an, mit führenden Forschungszentren für autonome Dysfunktion an größeren, randomisierten Studien zu arbeiten, um die Fragestellungen weiter zu prüfen. Aus den bisherigen Daten lassen sich keine gesicherten Aussagen zur klinischen Wirksamkeit ableiten.
Fazit
Nach der akuten Phase der Pandemie stellt Long COVID eine fortdauernde Herausforderung für das Gesundheitssystem dar, die vertiefte Forschung zum Verständnis der Pathophysiologie und zur Bewertung möglicher Behandlungsansätze erfordert. Aktuelle Arbeiten heben die Bedeutung von Hyperinflammation und Dysautonomie hervor und diskutieren nicht-invasive neuromodulatorische Verfahren als Forschungsansatz. Für eine belastbare Bewertung sind jedoch weitere, qualitativ hochwertige Studien erforderlich.
Dieser Beitrag erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ersetzt keine medizinische Beratung und enthält keine Werbung für bestimmte Produkte oder Verfahren. Entscheidungen zur Diagnostik oder Therapie sollten individuell und in Abstimmung mit medizinischem Fachpersonal getroffen werden.
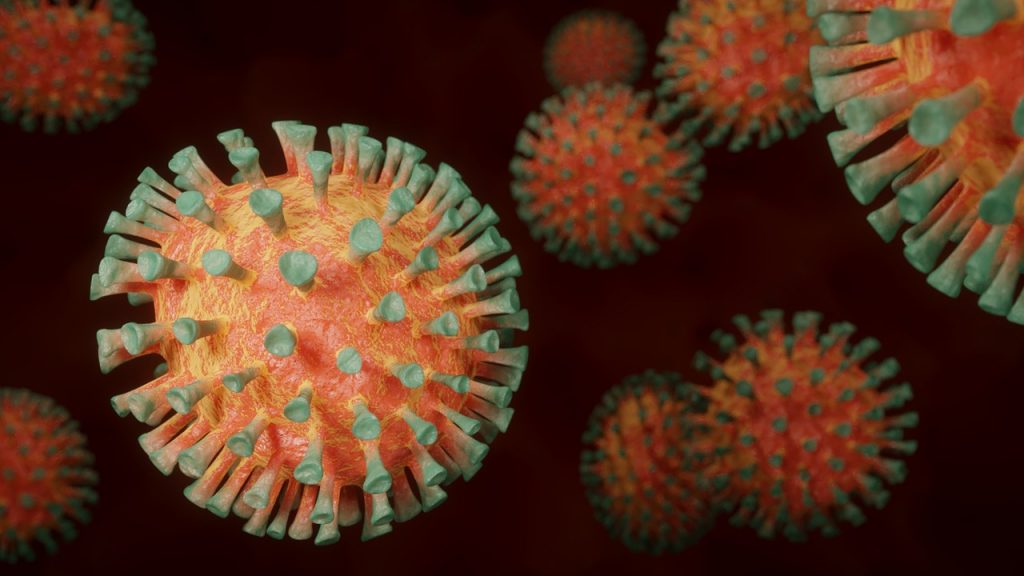
Referenzen:
Weltgesundheitsorganisation, Covid-19-Dashboard
COVID-19-Schnellrichtlinie: Management der langfristigen Auswirkungen von Covid-19. NICE-Leitlinie [NG188] Veröffentlicht am: 18. Dezember 2020
Warum sind Frauen anfälliger für Langzeit-Covid?, The Guardian, 13/6/2021
Proal AD und VanElzakker MB (2021) Long COVID oder Postakute Folgen von COVID-19 (PASC): Eine Übersicht über biologische Faktoren, die zu anhaltenden Symptomen beitragen können. Front. Microbiol. 12:698169
Fudim M, Qadri YJ, Ghadimi K, MacLeod DB, Molinger J, Piccini JP, Whittle J, Wischmeyer PE, Patel MR, Ulloa L. Implikationen für die Neuromodulationstherapie zur Kontrolle von Entzündungen und damit verbundenen Organfunktionsstörungen bei COVID-19. J Cardiovasc Transl Res. 2020 Dez;13(6):894-899.
Bonaz B, Sinniger V und Pellissier S (2021) Therapeutisches Potenzial der Vagusnervstimulation bei entzündlichen Darmerkrankungen. Front. Neurosci. 15:650971.
Dani M, Dirksen A, Taraborrelli P, et al. Autonome Dysfunktion bei ‚Lang-COVID‘: rationale, Physiologie und Managementstrategien. Clin Med (Lond). 2021;21(1):e63-e67. doi:10.7861/clinmed.2020-0896
Raveendran, A. V., Jayadevan, R., & Sashidharan, S. (2021). Langzeit-COVID: Eine Übersicht. Diabetes & Stoffwechselsyndrom, 15(3), 869–875. https://doi.org/10.1016/j.dsx.2021.04.007.
Proal, A.D. und VanElzakker, M.B., 2021. Langzeit-COVID oder Postakute Folgen von COVID-19 (PASC): Eine Übersicht über biologische Faktoren, die zu anhaltenden Symptomen beitragen können. Frontiers in Microbiology, 12, p.1494.
Haftungsausschluss: Bitte beachten Sie, dass Parasym keine medizinische Beratung anbietet. Die bereitgestellten Informationen sind nicht dazu gedacht, die Betreuung oder Beratung durch Ihren Arzt oder einen qualifizierten Gesundheitsfachmann zu ersetzen. Konsultieren Sie immer Ihren Arzt für alle Diagnosen und Behandlungen von Krankheiten oder Zuständen, einschließlich etwaiger Änderungen Ihres Gesundheitsregimes.
Natürliche Schmerzlinderung für Frauen: TENS‑Therapie bei Menstruations‑ und Beckenschmerzen
Natürliche Schmerzlinderung für Frauen: TENS‑Therapie bei Menstruations‑ und Beckenschmerzen Inhaltsverzeichnis...
Weiter lesen...Schmerzfreie Hautstraffung ohne Nebenwirkungen
Was kann man gegen den natürlichen Prozess der Hautalterung tun?...
Weiter lesen...10 Gründe für die Verwendung von TensCare Maternity TENS zur Schmerzlinderung während der Geburt
Die Ultraschall Therapie wird schon seit vielen Jahren sowohl für...
Weiter lesen...


